Die 10 bekanntesten Neuromythen von Philippe Lacroix
20.03.2019 • 10 Minuten
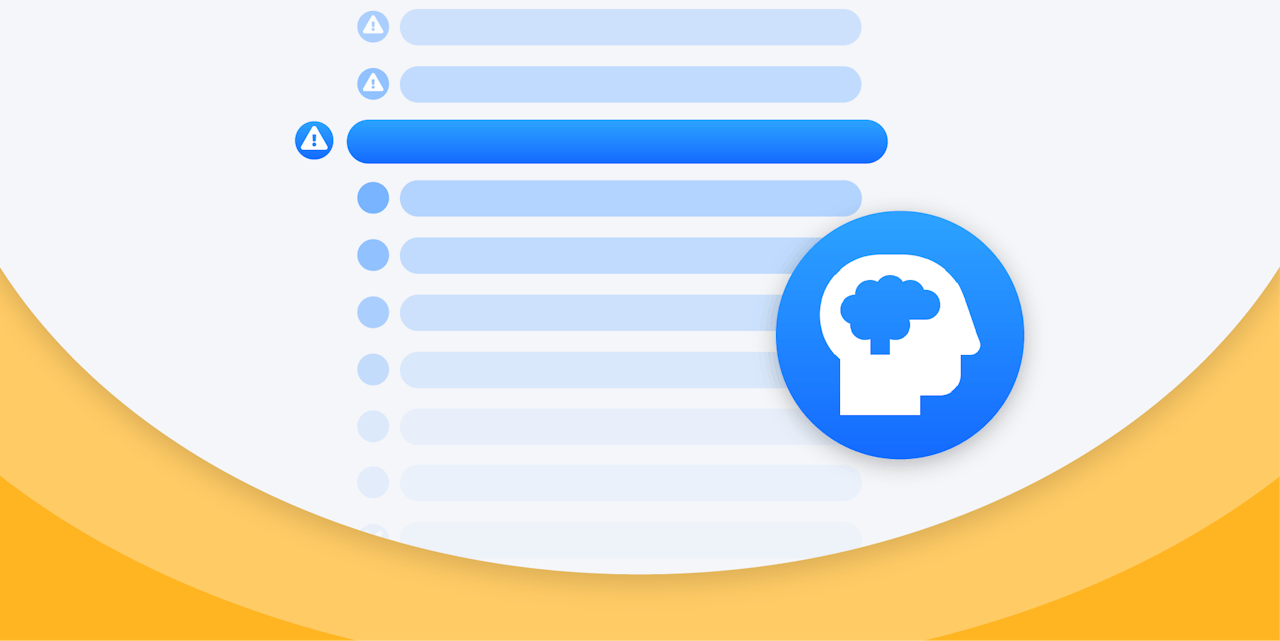
Was ist ein Neuromythos?
Neuromythen sind Fehlvorstellungen über die Funktionsweise des menschlichen Gehirns. Aufgrund von Vereinfachungen der Medien, politischen und kommerziellen Motiven sowie dem Publikationsdruck unter Forschenden akzeptiert man fälschlicherweise irrige, unvollständige oder vorläufige Annahmen als bahnbrechende Erkenntnisse. Obwohl die meisten dieser Mythen letztlich widerlegt werden, sind sie in den Köpfen der Menschen meist schon fest verankert. Im Folgenden stellen wir Ihnen 10 der bekanntesten Neuromythen und ihre angeblich „neurowissenschaftlichen“ Begründungen vor.
1. „Wir nutzen nur etwa 10% unseres Gehirns“
Dieser Mythos hält sich hartnäckig: Wir würden lediglich einen Bruchteil unseres Gehirns nutzen und somit großes Potenzial verschenken. Sein Ursprung reicht wohl bis in die 1930er Jahre zurück, als die ersten Gehirnstudien durchgeführt wurden. Die damaligen Messgeräte waren nicht empfindlich genug und zeigten scheinbar „stille“ Bereiche, was den Eindruck erweckte, dass unser Gehirn nur teilweise genutzt werde. Eine andere Theorie besagt, dass die Beschreibung des Gehirns als eine Summe von stark spezialisierten Arealen dazu führte, zu glauben, dass immer nur eines dieser Zentren aktiv sein könne. Angeblich habe sogar Einstein behauptet, er benutze nur 10% seines Gehirns. Auch moderne Hirnbildgebung könnte diesen Mythos fördern, da sie suggeriert, nur farbige Bereiche im Bild seien aktiv, wohingegen diese lediglich eine höhere Aktivität im Vergleich zu anderen Arealen zeigen.
Tatsächlich belegen neurowissenschaftliche Aufnahmen, dass wir zu jedem Zeitpunkt zahlreiche miteinander vernetzte Bereiche aus beiden Hemisphären nutzen. Selbst bei grundlegenden Inaktivitäten, ja sogar im Schlaf, ist das gesamte Gehirn aktiv. Sein Potenzial entwickelt sich dank der sogenannten neuronalen Plastizität – also der Fähigkeit des Gehirns, sich in jedem Alter zu verändern, zum Guten wie zum Schlechten.
2. „Menschen sind entweder rechts- oder linkshirnig“
Oft hört man, kreative Menschen hätten ein „Rechtsgehirn“, während rationale Menschen eher „linkshirnig“ seien. Die Behauptung, dass wir eine Gehirnhälfte dominanter nutzen als die andere, hat jedoch keine wissenschaftliche Grundlage. Der berüchtigte Online-Test mit der rotierenden Tänzerin zur Bestimmung dieses angeblichen Profils zeigt in Wirklichkeit nur eine ganz andere Fähigkeit des menschlichen Gehirns: die bistabile Wahrnehmung eines mehrdeutigen Reizes. Die Szene kann in zwei Richtungen interpretiert werden (Drehung nach links oder rechts). Das Gehirn entscheidet sich zunächst für eine Wahrnehmung, bevor es später umspringt.
Dieses Fehlverständnis basiert darauf, dass gewisse Funktionen zwar vorwiegend in einer Hemisphäre angesiedelt sind, d.h. es gibt eine gewisse Spezialisierung – diese Asymmetrie hat jedoch nichts mit der Persönlichkeit zu tun. Die linke Hemisphäre ist z.B. bei Rechtshändern Sitz der Hauptfunktionen des Sprechens, die rechte ist besser für das räumliche Sehen geeignet. Doch die meisten Aufgaben erfordern die Zusammenarbeit beider Hemisphären, die durch den sogenannten Balken (Corpus Callosum) eng miteinander verbunden sind. Egal ob wir denken oder kreativ sein wollen, beide Gehirnhälften arbeiten immer zusammen.
Dieser Mythos ermöglichte es einer Generation von Personalentwicklungsberater:innen und HR-Spezialist:innen, zwischen 1990 und 2000 auf eine beispiellose Welle von Publikationen und Seminaren aufzuspringen.
3. „Alles Lernen findet in der frühen Kindheit statt“
Laut diesem Irrglauben ist es entscheidend, gewisse Dinge vor einem bestimmten Alter zu lernen, da dies später sehr schwer oder gar unmöglich sei. „Alles passiert zwischen 3 und 6 Jahren“, so will es dieser Mythos weismachen.
Neuronale Plastizität – also die Fähigkeit des Gehirns, sich umzuformen – ist zwar am Anfang des Lebens am stärksten ausgeprägt, weshalb Kinder so schnell lernen. Man spricht daher von „sensiblen“ oder „kritischen“ Phasen. Lernen ist aber auch danach weiterhin möglich, es braucht lediglich mehr Zeit und ist etwas schwieriger. Der Mensch ist neurologisch darauf angelegt, sein Leben lang zu lernen – bis ins hohe Alter hinein.
Dieser Artikel basiert auf dem Buch „Neuro Learning: Les neurosciences au service de la formation“ – ein Werk, das „ein pädagogisches Kunststück darstellt, indem es einen höchst disruptiven Prozess in eine Vielzahl neuer Lernmöglichkeiten verwandelt“.
4. „Es gibt drei Lernstile“
Dieser Mythos, der besonders unter Lehrkräften Verbreitung fand, behauptet, jeder Mensch habe einen bevorzugten Lernstil: visuell, auditiv oder kinästhetisch. Diese Präferenzen, soweit sie existieren, sind in Wirklichkeit lediglich Arbeitsgewohnheiten – und die Wissenschaft zeigt, dass ihre Berücksichtigung keinen Vorteil bringt.
Unabhängig von eventuell vorhandenen Vorlieben ist der Mensch in erster Linie ein „visuelles Wesen“. Es ist erwiesen, dass das Hinzufügen eines Bildes zu einer Erklärung den Lernerfolg bei allen fördert; eine Vielfalt von Sinnesmodalitäten unterstützt Aufmerksamkeit und Gedächtnis bei allen Lernenden.
Auch aktuelle Überlegungen von Erwachsenenbildner:innen stellen das ganze Konzept der „Lernstile“ zunehmend infrage.
5. „Mozart hören macht intelligent“
Dieser Mythos basiert auf einem wissenschaftlichen Irrtum. 1973 veröffentlichten US-amerikanische Forscher im renommierten Nature-Magazin eine Studie, wonach das Hören einer Mozart-Sonate den IQ steigern würde. Drei Erwachsenengruppen absolvierten vor und nach dem Anhören entweder von Mozart, eines Entspannungslieds oder von gar nichts eine Reihe kognitiver IQ-Tests. Die „Mozart“-Gruppe zeigte einen leichten Anstieg beim räumlichen Denken – doch diese Wirkung hielt nur wenige Minuten an. Die übrigen Tests zeigten keine Effekte, und obwohl diese Ergebnisse äußerst vorläufig waren, verbreiteten sie sich weltweit.
Erst mehr als fünfzehn Jahre später zeigte sich: Obwohl die Studie streng durchgeführt worden war, hatte sie unzuverlässige Ergebnisse geliefert. In der Zwischenzeit hatte sich der Mythos jedoch festgesetzt, und sogenannte „Mozart-Effekt“-Produkte überfluteten den weltweiten Bildungsmarkt und versprachen, die Intelligenz kleiner Kinder, sogar im Mutterleib, zu fördern – obwohl die Studie ausschließlich an Erwachsenen durchgeführt worden war.
Auch wenn der „Mozart-Effekt“ sich als wissenschaftliches Trugbild erwiesen hat, legen neuere Forschungsergebnisse nahe, dass das aktive Musizieren in der Kindheit die kognitive Entwicklung fördert (White-Schwoch, 2013).
6. „Das sogenannte Brain Gym® verbessert das Lernen“
Das Brain Gym®-Programm verspricht, durch eine Reihe von Übungen den Informationsaustausch zwischen beiden Gehirnhälften zu fördern. Zum Beispiel wird empfohlen, durch das linke Nasenloch zu atmen, um die rechte Hirnhälfte zu stimulieren – was keinerlei wissenschaftliche Basis hat.
Von einer britischen Lehrkraft entwickelt und in achtzig Ländern verkauft, behauptet diese Methode fälschlicherweise, auf den Neurowissenschaften zu basieren. Trotz Aufklärungskampagnen der Wissenschaft findet das Programm weiterhin Anklang bei Lehrkräften weltweit. Die Autoren haben jedoch die abwegigsten Behauptungen in der aktuellen Auflage entfernt.
Obwohl körperliche Aktivität grundsätzlich positive Effekte auf das Gehirn hat, wurde Brain Gym® von der wissenschaftlichen Gemeinschaft einhellig abgelehnt.
7. „Frauen und junge Gehirne sind besser im Multitasking“
Oft hört man, dass Frauen und jüngere Generationen besonders multitaskingfähig seien. Auf die Frage „Sind sie produktiver, wenn sie mehrere Dinge gleichzeitig tun?“ antwortet die Wissenschaft eindeutig mit „Nein“. Im Gegenteil, das gleichzeitige Durchführen mehrerer Aufgaben überfordert das Gehirn. Deshalb ist zum Beispiel das Telefonieren während des Autofahrens verboten.
Zwei Aufgaben parallel zu erledigen, ist nur möglich, wenn eine davon vollständig automatisiert ist – etwa reden beim Gehen. Doch auch dabei kann die automatische Tätigkeit jederzeit durch neue Reize unterbrochen werden. Unabhängig von Alter oder Geschlecht arbeitet das Gehirn am besten, wenn es sich auf jeweils eine Aufgabe konzentriert.
8. „Männer und Frauen verfügen über völlig unterschiedliche Intelligenz“
Häufig hört man, Männer und Frauen hätten völlig unterschiedliche Intelligenz und Männer seien beispielsweise besser in Mathematik. Stimmt das? Anatomisch ist das männliche Gehirn tatsächlich größer und schwerer als das weibliche. Es gibt auch funktionale Unterschiede: Das Sprachzentrum etwa ist bei Frauen aktiver. Auch hormonelle Unterschiede sind vorhanden. Doch bislang konnte kein Zusammenhang zwischen diesen Abweichungen und kognitiven Fähigkeiten nachgewiesen werden.
Zwar ergaben alte Studien, dass Jungen besser in Mathematik seien als Mädchen – neuere Untersuchungen widerlegen dies jedoch. Eine Studie aus 86 Ländern zeigte: Falls es überhaupt Unterschiede gibt, sind sie minimal und eher auf soziale Faktoren als auf das Geschlecht zurückzuführen. Eine Metaanalyse erbrachte zudem, dass Schülerinnen in den letzten 100 Jahren in allen Fächern im Schnitt bessere Noten als Schüler erzielten.
Obwohl sich also biologische Unterschiede im männlichen und weiblichen Gehirn feststellen lassen, gibt es dafür bislang keine bedeutsamen Auswirkungen auf die Intelligenz – zumal diese wissenschaftlich ohnehin nicht eindeutig definiert ist.
9. „Brain Training“-Videospiele sind sehr effektiv“
Brain training-Spiele, die das Gehirn stimulieren sollen, sind in den USA sehr verbreitet und seit einigen Jahren auch in Europa gefragt. Verbessern sie wirklich die kognitive Leistungsfähigkeit auf Dauer? Viele Studien widmen sich dieser Frage – bislang sind die Ergebnisse enttäuschend. Eine Gruppe von Wissenschaftlern hat sich sogar zusammengeschlossen, um die Produkte kritisch in der Öffentlichkeit zu beleuchten.
Eine umfangreiche Untersuchung, veröffentlicht in Nature, verglich drei Trainingsmethoden bei 11.430 Erwachsenen:
- Brain training-Videoübungen
- Klassisches logisches Denken und Problemlösen
- Das Beantworten normaler Fragen mithilfe des Internets
Nach sechs Wochen hatten alle Gruppen ihre kognitiven Werte im gleichen Maße gesteigert.
Zwei französische Schulstudien zeigten, dass Nintendo Brain training-Ergebnisse ähnlich ausfielen wie bei klassischen Aufgaben mit Papier und Stift.
Abgesehen von wenig überzeugenden Resultaten stellt sich die Hauptfrage der Übertragbarkeit dieser Fähigkeiten in den Alltag. Wer etwa in einem Spiel seine Punktzahl verbessert, indem er schneller auf ein Ziel klickt, steigert damit nicht zwangsläufig die kognitive Leistung im echten Leben.
Drei seriöse – wenn auch noch vorläufige – Forschungsansätze zeichnen sich ab:
- Training des Arbeitsgedächtnisses, insbesondere bei Menschen mit Aufmerksamkeitsdefizit-Störung;
- Förderung von Aufmerksamkeit und exekutiven Funktionen;
- Einfache, handlungsorientierte Videospiele könnten räumliches Denken auf allgemeine und dauerhafte Weise unterstützen.
10. „Man kann im Schlaf lernen“
Der Mythos, dass Menschen im Schlaf lernen könnten, ist nicht neu. Wissenschaftler:innen der ehemaligen Sowjetunion untersuchten diese Frage schon in den 1950er und 60er Jahren. Einige ihrer Studien kamen zwar zu positiven Ergebnissen, doch die Methoden waren gravierend fehlerhaft. Deshalb konnten Forscher aus westlichen Ländern diese Ergebnisse nie replizieren.
Um zu lernen, muss man wach sein, denn Lernen erfordert bewusste Anstrengung. Auch wenn wir im Schlaf nicht lernen können, ist er dennoch extrem wichtig für die Entwicklung und Funktion des Gehirns: Schlaf festigt das, was wir im Wachzustand gelernt haben.
Wie Neurowissenschaften Mythen widerlegen
Fünf wissenschaftliche Fakten
- Wir nutzen 100% unseres Gehirns.
- Multitasking = Langsamkeit + Fehler.
- Unser Gehirn ist auf lebenslanges Lernen ausgelegt.
- Wir sind alle in erster Linie „visuell“.
- Männer- und Frauengehirne: mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede.
Fünf von der Wissenschaft widerlegte Theorien
- Visuelle/auditive/kinästhetische Lernmethoden
- Rechts/links-Gehirn-Ansätze
- Der „Mozart-Effekt“
- Brain Gym®
- Brain training-Videospiele
Quellen
Dieser Artikel basiert auf dem Buch „Neuro Learning: Les neurosciences au service de la formation“ – ein Werk, das „ein pädagogisches Kunststück darstellt, indem es einen höchst disruptiven Prozess in eine Vielzahl neuer Lernoptionen verwandelt“.
Quelle: Medjad, N., Gil, P., & Lacroix, P. (2017).Neuro Learning: Les neurosciences au service de la formation.Paris: Eyrolles.
Autor*in

Gauthier Lebbe
Inhaltsredakteur @Wooclap. Ich liebe es zu schreiben, zu lernen, über das Lernen zu schreiben und über das Schreiben zu lernen. Und die Leser mit Wortspielen zu überraschen, die sie nicht kommen sehen. Sie wissen schon, schwache Wortspiele.
Thema
Eine Zusammenfassung der neuen Produktentwicklungen und aktuellen Inhalte, die einmal im Monat in Ihrer Mailbox erscheint.


